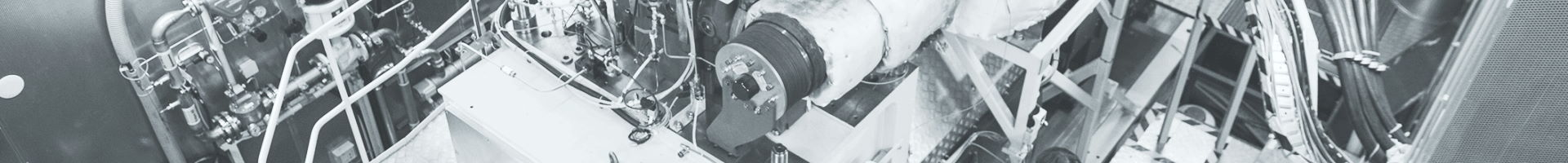Die komplexe Infrastruktur des Gesamtenergiesystems an Bord von Passagierschiffen wie Fähren und Kreuzfahrtschiffen kann mit einer Kleinstadt verglichen werden. Diese Komplexität ergibt sich aus ihrer Aufgabe, nämlich dem Transport von Menschen sowie ggf. Fahrzeugen und Gütern, bei der zugleich die verschiedensten Bedürfnisse der Passagiere abgedeckt werden sollen.
Die komplexe Infrastruktur des Gesamtenergiesystems an Bord von Passagierschiffen wie Fähren und Kreuzfahrtschiffen kann mit einer Kleinstadt verglichen werden. Diese Komplexität ergibt sich aus ihrer Aufgabe, nämlich dem Transport von Menschen sowie ggf. Fahrzeugen und Gütern, bei der zugleich die verschiedensten Bedürfnisse der Passagiere abgedeckt werden sollen.
Neben dem übergeordneten Ziel einer gesteigerten Energieeffizienz kommen die steigenden Anforderungen hinsichtlich der Gesetzgebung wie der Reglementierung der Schadstoffemissionen und eine zunehmende Sensibilisierung in der breiten Öffentlichkeit bezüglich der Emissionen und dem CO2-Fußabdruck der Schifffahrt hinzu. Um diesen gerecht zu werden, nimmt die Komplexität der Technologien zur Energieerzeugung, -speicherung und -wandlung sowie dem effizienten Einsatz gezwungenermaßen ebenso stetig zu wie die Weiterentwicklung der Antriebskonzepte der betroffenen Schiffe.
Das Routenprofil der besagten Schiffsklassen besteht häufig aus küstennahen Fahrten und dem tageweisen Betrieb innerhalb verschiedenster Häfen. Bezogen auf den Maschinen- und Anlagenbetrieb ergibt sich daraus neben dem stationären Betrieb auf hoher See und ggf. während der Hafenliegezeiten ein hoher Anteil an Manöverfahrten, welcher durch ein sehr dynamisches Betriebs- bzw. Nutzungsverhalten geprägt ist. Gleichzeitig generieren auch die Energiebedarfe aus dem Hotelbetrieb ein instationäres Lastprofil, was der nautischen bzw. antriebsseitigen Lastdynamik überlagert ist und vom Leistungsbedarf her in einer vergleichbaren Größenordnung liegt, jedoch nie in den primären Fokus von Politik und Gesellschaft gerückt ist.
Aus diesen Betriebsregimes der vergangenen Jahre, die sich in Zukunft noch intensiver manifestieren werden, ergibt sich ein breites Band verschiedener Optimierungspotentiale. Für Optimierungsmaßnamen müssen allerdings die Auswirkungen und Wechselwirkungen bekannt sein bzw. ermittelt und gleichzeitig kunden-/passagierspezifische Komfortanforderungen berücksichtigt werden. Wünschenswert wäre an dieser Stelle ein digitales Optimierungswerkzeug, welches die angesprochenen Systeme in Form einer Simulation abbilden kann. Somit kann der Einfluss verschiedener Vorgehensweisen für unterschiedliche Situationen simulativ abgeschätzt und anschließend quantitativ bewertet werden.

Um den steigenden ökonomischen wie ökologischen Ansprüchen und der engen Verzahnung von Subsystemen gerecht zu werden, ist es das gesetzte Ziel des Projekts SimPleShip (Simulation Platform for efficient Ships), die folgenden Aspekte in einer ganzheitlichen Simulationsumgebung durch die Bildung eines „Digital Twin“ zu optimieren:
- Energetische Infrastruktur
- Antriebstechnologien
- Dynamischer Maschinenbetrieb / Manövrieren
Zur Bearbeitung dieser komplexen Aufgabenstellung hat sich ein hochqualifiziertes Konsortium zusammengefunden. Gemeinsam mit dem Institut für innovative Schiffs-Simulationen und Maritime Systeme (ISSIMS) der Hochschule Wismar sowie dem Lehrstuhl für Technische Thermodynamik der Universität Rostock entwickelt die FVTR GmbH eine Simulationsplattform, die alle passagier- bzw. kreuzfahrtschiffstypischen Aspekte abdeckt - von Energieerzeugung in konventionellen oder hybridisierten Antriebssystemen über Energiespeicherung in Tanks, Kesseln, Pools, Verteilsystemen und der Raumluft, bis hin zum Energieverbrauch für die Schiffsführung und alle hotelseitigen Bedarfe. Unterstützt wird das Konsortium dabei durch den assoziierten Partner Carnival Maritime GmbH, welcher als Betreiber der Kreuzfahrtschiffe der Marken Costa Crociere und AIDA Cruises auf einen immensen Erfahrungsschatz im Schiffsbetrieb zurückgreifen kann. Durch den hochinstrumentierten Schiffsbestand kann der Projektverbund auf eine umfangreiche Messdatenbasis zur Entwicklung und Validierung von Modellen zurückgreifen.
Die Simulationsplattform
Das übergeordnete Ziel des Forschungsprojektes besteht in der Entwicklung einer digitalen Simulationsplattform zur thermodynamischen Analyse und energetischen Optimierung von komplexen, gekoppelten Schiffssystemen. Neben der Schaffung einer physikalisch basierten Aggregatbibliothek zur Simulation von Dieselmotoren, Brennstoffzellen, Batterien, thermischen Speichern, Verteilsystemen sowie den Vortriebs- und Steuerorganen, liegt ein besonderer Fokus auf passagierschifftypischen Anlagen, welche die sogenannte Hotellast darstellen.
Das digitale Simulationswerkzeug wird insbesondere auch zur energetischen Analyse und Optimierung des Gesamtsystems „Schiff“ in transienten Betriebszuständen geeignet sein. Dadurch sind Potentialanalysen und Optimierung vor dem Hintergrund bestimmter Szenarien möglich. Beispielhaft seien energetisch optimierte Hafenein- und -ausfahrten sowie der gleichzeitige Hafen- und Hotelbetrieb genannt. Perspektivisch wird durch die Analyse einer Einbindung von Speichersystemen und alternativen Erzeugungseinheiten unter anderem abschätzbar sein, ob ein Anlegemanöver unter der Vorgabe „Zero-Emission“ (wie z.B. in norwegischen Häfen ab 2025 gefordert) möglich ist und welche Voraussetzung hierfür geschaffen werden müssen.
Im Ergebnis wird die Plattform eine vollumfängliche Bibliothek beinhalten, welche alle wesentlichen technischen Aspekte von Passagierschiffen abdeckt. Dies befähigt den Anwender (z.B. Reeder, Werften, Schiffsbetreiber, Dienstleister) zu quantitativ bewertbaren Szenario- und Retrofitanalysen bestehender Schiffe. Gleichzeitig kann bereits währende der Projektierungs- und Auslegungsphase von Neubauten durch die parallele Nutzung der Simulationsplattform mit den darin enthaltenen Komponenten- und Systembibliotheken eine realitätsnahe Evaluation der Gesamtwirkungsgrade im spezifisch geplanten Betriebsumfeld durchgeführt werden.